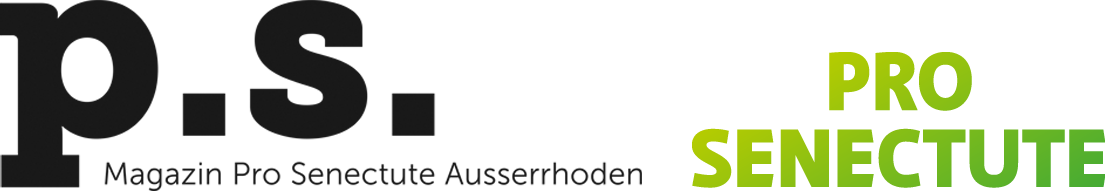Seit Aschermittwoch, 22. Februar, und noch bis Karsamstag, 8. April, wird gemäss christlicher Tradition gefastet. Wir haben eine Klosterfrau und einen Ernährungsberater gefragt, auf was es dabei ankommt.
In der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern ist es vielerorts üblich, völlig oder teilweise bestimmten Speisen, Getränken und Genussmitteln zu entsagen. Im Unterschied zu einer Diät geht es beim Fasten nicht um Gewichtsabnahme, sondern in erster Linie um Entgiftung und Regeneration. «Diäten sind meist ‹Gelddruckmaschinen› ohne langfristigen Effekt, da bin ich ein absoluter Gegner», erklärt Oliver Schlatter, Ernährungsberater in der Klinik Gais, und fährt fort: «Im Gegensatz dazu kann ich voll hinter dem spirituellen Fasten stehen, denn bewussteres Essen ist wertvoll für Körper und Geist».
Messbare positive Effekte
Was erstrebenswert klingt, kann aber auch seine Tücken haben. Schlatter betont: «Es gibt ganz klare Regeln. Nur ein gesunder Mensch darf fasten. Gesund ist, wer trinken kann, beweglich und normalgewichtig ist. Schwere Erkrankungen, Essstörungen oder Untergewicht sind genauso Ausschlusskriterien wie die Zeit während einer Genesung. Im Zweifel sollte ohnehin immer ein Arzt nach seiner Meinung gefragt werden.» Von der medizinischen Warte aus würden bei richtig ausgeführtem Fasten messbare positive Effekte auf die Gesundheit beobachtet, so der Fachmann. Und er verdeutlicht: «Nahrungsreduktion verändert den Körper. Selbstheilungskräfte und Zellreinigung werden aktiviert.»
Fasten als Droge
Aus religiöser Sicht dient das Fasten unter anderem der Reinigung der Seele und der Busse. Im Kloster Leiden Christi in Jakobsbad wird die Fastenzeit als eine Zeit der Besinnung und des Umdenkens gelebt. Oder wie es Schwester Elisabeth formuliert: «Es ist eine Zeit der Versöhnung und des Aufbruchs. Ausserdem verstehen wir die Fastenzeit als eine Zeit der Neuwerdung des Menschen.» In die gleiche Kerbe schlägt Oliver Schlatter, der die Frage in den Raum stellt: «Was bleibt in unserem Leben, wenn wir die Nahrungsaufnahme weglassen?» Die Antwort liegt auf der Hand: Es entsteht viel Raum für Gedanken und Achtsamkeit. Fasten könne sogar zu Bewusstseinserweiterungen führen, weiss der Ernährungsberater: «Der Körper nennt fasten hungern. Er schaltet also von ‹Dauerüberernährung› um auf ‹Hungerstoffwechsel›. Ein Effekt dieser Strategie ist, Endorphine, also körpereigene Drogen, auszuschütten – für den Kopf wirkt Fasten daher wie eine Erweckung». Schlatter beschreibt damit einen faszinierenden Mechanismus, den die Evolution geschaffen hat. «Fasten gab es schon immer – früher einfach unfreiwillig während Hungersnöten. Der Körper wurde darauf angepasst, Hungerzeiten zu überstehen. Er hat gelernt mit Ernährungsmangel umzugehen.»
Selbst auferlegter Verzicht
An Aschermittwoch sowie Karfreitag gibt es im «Klösterli» nach alter Tradition keine Fleischspeisen und in den letzten zwei Wochen vor Ostern wird weniger und bewusster gegessen. «Während der ganzen Fastenzeit entscheidet jede Schwester nach Mass der Gesundheit und des Möglichen, worauf sie verzichtet. Aber nicht nur das: Die Fastenzeit bietet den Schwestern Gelegenheit, sich neu auszurichten, sich aufzurichten und die wichtigen Fragen des Lebens zu betrachten», erklärt die Kapuzinerin und ergänzt: «Die älteren Mitschwestern sind vom Fasten ausgenommen. Wir sind dankbar, wenn sie nach einem erfüllten und arbeitsreichen Leben mit Freude und Appetit an den Konventstisch kommen.»
Genuss braucht den Mangel
Wie erwähnt, ist es nicht für alle Menschen ratsam, die Ernährung zu reduzieren. Gebrechlichen oder gesundheitlich Angeschlagenen wäre es laut Schwester Elisabeth beispielsweise als Variante möglich, dass sie in der Fastenzeit ihre Marotten und Gewohnheiten überdenken und diese eventuell ändern. «Fasten bedeutet nicht immer Verzicht auf Genuss und Lebensmittel, sondern sich mit dem eigenen Leben auseinanderzusetzen. Was brauche ich wirklich zum Leben? Was kann ich ändern, für mich und die Welt?», erläutert sie. «Fasten ist eine Praxis, die tief in den Religionen verankert ist», sagt die Klosterfrau weiter und zieht als Fazit: «Fasten kann uns neue Dankbarkeit schenken für die Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Verzicht kann uns ein neues Bewusstsein für scheinbare Alltäglichkeiten geben.» Sichtweisen, die auch Oliver Schlatter teilt. «Wenn jemand religiös fastet, macht ihn das wieder ein wenig demütiger», sagt er und zeichnet ein einprägsames Bild: «Wenn ich ein Stück Kuchen esse, habe ich den höchstmöglichen Genuss. Esse ich ein zweites Stück, ist das auch noch lecker, aber nicht mehr ganz so fein. Und spätestens nach vier Stücken wird mir sogar schlecht. Verzichte ich aber ganz auf Kuchen, bekommt er eine ganz neue Bedeutung.» Ein gutes Beispiel dafür, dass Genuss immer auch mit Mangel verbunden ist.
Mit Augenmass Mass halten
Wer nun Lust auf einen leeren Magen bekommen hat, dem legt der Ernährungsberater folgende Tipps ans Herz: Beim ersten Fasten sollte man sich unbedingt in Kurhäusern oder Gruppen begleiten lassen – das erhöht den Effekt und ist sicherer. Und obwohl fit und gesund sein heute nicht mehr altersabhängig sind, empfiehlt der Experte ab dem sechzigsten Altersjahr einen vorgängigen Check beim Arzt. Denn allenfalls kann es ratsam sein, während dem Fasten zusätzlich Eiweiss aufzunehmen, damit es nicht zu einem Muskelabbau kommt. Wichtig ist auch eine hohe Trinkmenge, so können im Körper gelöste Giftstoffe besser ausgeschieden werden. Zu guter Letzt sollte der Blick auch auf das Ende der enthaltsamen Zeit gerichtet werden. Wenn wieder mit dem Essen begonnen wird und der Darm in Gang kommen muss, kann fachliche Unterstützung hilfreich sein.
Und übrigens, für alle, die am Fasten zu kauen haben: Es spricht nichts dagegen, sich an Ostern mit einem kleinen Schoggihasen für die Entbehrungen zu belohnen.