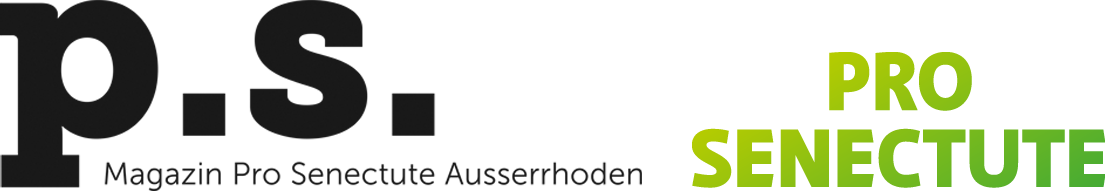Anni Schefer wurde vor sieben Jahren schwerhörig. Sie lässt sich im Alltag nicht einschränken. Ein Hörimplantat und ihre Unternehmungslust helfen dabei.
Mit siebzig erlitt Anni Schefer ihren achten Hörsturz. Das war vor sieben Jahren. Jedes Mal zuvor hatte der «Ohrinfarkt» von selbst geheilt. Diesmal nicht. «Ich hätte innerhalb von 24 Stunden zum Arzt gehen sollen», tadelt sie sich: «Doch ich wartete drei Tage. Denn ich glaubte, das Ohr ist nur verstopft und das Hören stellt sich wieder ein.» Es kam anders. Das rechte Ohr blieb taub. Die Welt von Anni verstummte. Ihr Hörvermögen lag noch bei zwanzig Prozent – selbst die schrille Hausglocke nahm sie nicht mehr wahr.
Es gibt Lösungen
Nun liegt der Wert wieder bei 65 Prozent. «Das ist für Leute in meinem Alter fast normal», weiss die Rentnerin und lacht: «Hundert Prozent schafft wahrscheinlich von meinen Jahrgängern niemand mehr.» Wie lässt sich diese Steigerung erklären? Anni behilft sich seit etwas über zwei Jahren mit einem Hörgerät im linken Ohr und im 2023 liess sie sich ein Implantat fürs rechte Ohr einsetzen. Dieses ist gekoppelt mit dem Hörapparat, Fernseher und sogar dem Smartphone. Chirurgen für so eine Operation lassen sich nicht an jeder Ecke finden. Anni ging für den Eingriff ins Unispital Zürich, wo sie zwei Tage bleiben musste. Dort wurde ihr ein Elektrodenträger, das Kernstück des Implantats, in die Hörschnecke eingeführt. Dieser regt die vorhandenen Nervenzellen elektrisch an. Während ein Hörgerät Schall lediglich verstärkt und auf eine Restfunktion der Haarzellen im Ohr angewiesen ist, kann ein Implantat direkt die Nervenzellen stimulieren.
Feineinstellungen und Training
Anni wählte ein Implantat, das aus zwei Teilen besteht: Einem eingepflanzten Teil und einem äusseren Gegenstück, dem Soundprozessor. Dieser wird wie ein Hörgerät hinter dem Ohr getragen. «Frauen können ihn gut hinter den Haaren verstecken», schätzt Anni die diskrete Konstruktion. Drahtlos sendet der Prozessor Signale durch die Haut an das Implantat. Zum Duschen oder beim Schlafen wird der äussere Teil abgelegt. In mehreren Schritten und über Monate verteilt, will der Apparat justiert werden, was jeweils eine Fahrt nach Zürich nötig macht. Parallel muss ein Hörtraining besucht werden. Die Trognerin kann dazu ein Angebot im Heimatdorf nutzen: Im Haus Vorderdorf erfährt Anni Unterstützung von einer Audioagogin.
Kostspielig und dennoch bezahlbar
Der Entscheid für das Gerät sei ihr nicht leicht gefallen, sagt Anni. Denn der Preis liegt bei 50’000 bis 60’000 Franken. Alleine der Aussenteil schlägt mit etwa 12 000 Franken zu Buche – eine Versicherung gegen Verlust ist also ratsam. An den Kosten beteiligten sich die Invalidenversicherung (IV) und Krankenkasse massgeblich. Der Selbstbehalt ist eine Investition, die sich in jedem Fall lohnt, wie Anni betont: «Man muss sofort und in jedem Alter etwas machen lassen, wenn man nicht mehr gut hört. Meist ringt man zu lange mit sich, ob man einen Eingriff oder eine Anschaffung wagen soll. Aber es zahlt sich aus – alleine wenn man bedenkt, dass eine Besserung unmittelbar eintritt», was sie mit einem anschaulichen Beispiel untermauert: «Bis man das Lippenlesen beherrscht, vergehen etwa zehn Jahre.»
Am Leben teilnehmen
Von Einschränkungen mag Anni nun nicht mehr reden: «Eigentlich kann ich überall teilnehmen. Ich muss auf nichts verzichten.» Und darauf legt sie Wert: «Es ist mir wichtig, raus zu gehen. Denn ein Rückzug fördert Demenz.» Anni schmunzelt, wenn sie erzählt, dass beim Altersturnen die Akustik in der Halle nicht optimal ist: «Wenn ich eine Anweisung nicht höre, schaue ich einfach, was die anderen machen.» Das empfindet sie nicht als Handicap. Denn auch wer gute Ohren hat, versteht nicht immer alles. Auch darum wünscht sich Anni, dass die Leute generell lauter, deutlicher und nicht durcheinander reden. Ein Wermutstropfen bleibt, da ihr Hörspektrum reduziert ist. Dumpfe, tiefe Töne nimmt sie besser wahr: «Es dauert mich, dass ich die Vögel nicht mehr höre.» Doch Anni hat nichts übrig für Selbstmitleid. Sie fügt sofort an: «Es ist mir lieber etwas nicht zu hören, als nicht zu sehen.» Und sie kann dem geschwundenen Hörvermögen sogar einen positiven Aspekt abgewinnen: «Wenn es mir zu laut wird, egal wo, kann ich einfach leiser drehen.»